Eisenschlamm-Revolution: Lausitz entdeckt neuen Boden-Schatz!
In Oberspreewald-Lausitz wird Eisenschlamm untersucht, um Brandenburger Böden aufzuwerten. Forschungsergebnisse in zwei Jahren erwartet.
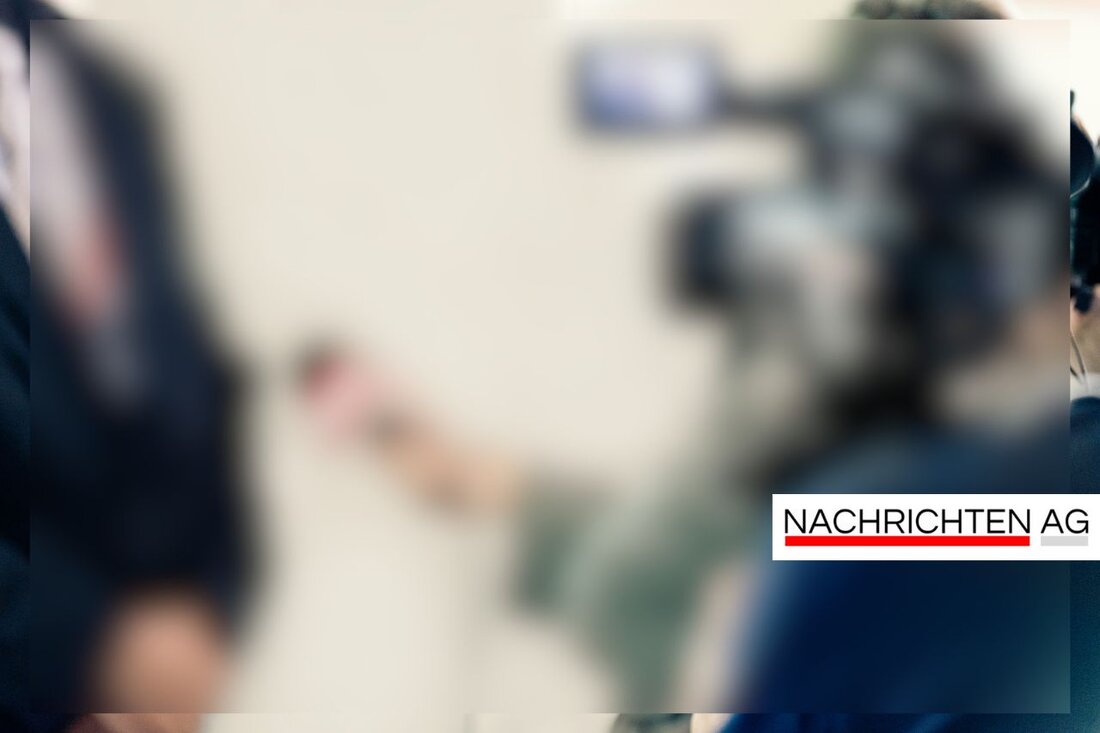
Eisenschlamm-Revolution: Lausitz entdeckt neuen Boden-Schatz!
In der Lausitz tut sich einiges im Bereich der Gewässer- und Bodenrenaturierung. Es wird fleißig daran gearbeitet, die durch den Braunkohlenbergbau geschädigten landschaftlichen Gegebenheiten zu verbessern. Vor wenigen Tagen hat die Entschlammung der Wudritz begonnen, einem wichtigen Zufluss zur Spree. Hier werden bis zu 24.000 Kubikmeter mit Eisenhydroxid belasteter Klärschlamm abgebaggert. Dies ist ein Teil des 20-Punkte-Sofort-Katalogs der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), der die Reinigung der Spree zum Ziel hat. Die Bagger sollen bis Mitte Juni einen Abschnitt von zwölf Kilometern entschlammen. Durch diese Maßnahmen erhofft man sich nicht nur, die Eisenbelastung der Spree zu reduzieren, sondern auch einen gesunden Lebensraum in der Region zurückzugewinnen. [Tagesspiegel] berichtet von den laufenden Projekten, die als notwendige Schritte zur Bekämpfung der ökologischen Spätfolgen des Kohlenabbaus angesehen werden.
Was genau ist dieser Eisenschlamm, der hier zur Sprache kommt? Er entsteht, nachdem das Grundwasser nach dem Ende eines Tagebaus ansteigt, was dazu führt, dass Eisenhydroxid als Schlamm abgelagert wird. Ein Forschungsteam untersucht nun, ob dieser Schlamm zur Aufwertung sandiger Böden in Brandenburg verwendet werden kann. Auf einer Versuchsfläche bei Lauchhammer werden Luzerne-Pflanzen auf unterschiedlichen Böden getestet, die mit dem Eisenschlamm versetzt sind. Die Forscher erhoffen sich, dass dieser Schlamm, nachdem er getrocknet und gesiebt wurde, wertvolle Nährstoffe für die Landwirtschaft bieten kann. Jährlich fallen etwa 60.000 Tonnen Eisenschlamm an, von denen schätzungsweise nur 10.000 Tonnen tatsächlich verwendet werden können. [RBB24] informiert über die besonderen Eigenschaften des Schlamms, der möglicherweise die Bodenqualität erheblich verbessern könnte.
Pflanzen und Böden im Fokus
Die Pflanzversuche zeigen vielversprechende Ansätze. Durch das Messen und Wiegen der Pflanzen wird untersucht, wie gut sie in Böden mit und ohne den Eisenschlamm gedeihen. Ein Labor unter den Versuchsbeeten fängt das Wasser auf, das durch die Messzylinder sickert, um einen genauen Überblick über die Bodenfeuchtigkeit zu haben. Bemerkenswert ist, dass die Schlämme in der Lage sind, Regenwasser zu speichern, was die Bodenqualität fördern kann. Doch nicht jede Schlammprobe ist willkommen, denn einige können Schwermetalle enthalten, die potenziell gesundheitsgefährdend sind.
Schwermetalle im Gartenboden sind ein ernstes Thema, das nicht zu unterschätzen ist. Sie können durch natürliche Verwitterungsprozesse, Industrieabfälle oder auch durch Klärschlamm in den Boden gelangen und sich dort anreichern. Die Liste der problematischen Metalle reicht von Blei über Cadmium zu Quecksilber. Diese Stoffe können langfristig gesundheitliche Schäden verursachen, weshalb eine gründliche Analyse oft ratsam ist. [Boden Fachzentrum] betont, dass insbesondere saure Böden (mit einem pH-Wert unter 7) ein höheres Risiko bergen.
Blick in die Zukunft
Die Forscher sind optimistisch, erwarten jedoch, dass sie in zwei Jahren erste belastbare Ergebnisse ihrer Studien vorstellen können. Es bleibt abzuwarten, wie die langfristigen Auswirkungen dieser Ansätze auf die Boden- und Wasserqualität sowie die angrenzenden Ökosysteme sind. Klar ist, dass die Nutzung von Eisenschlamm weiterhin mit Vorsicht betrachtet werden muss, insbesondere im Hinblick auf die Gefahren durch Schwermetalle.
Insgesamt ist der Reinigungsprozess der Spree und die mögliche Nutzung des Eisenschlamms wichtige Schritte auf dem langen Weg zu einer regenerierten Landschaft. Es ist zu hoffen, dass durch diese Initiativen die Umwelt in der Lausitz nicht nur gereinigt, sondern auch aufgewertet wird.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto