Schwimmen im Plötzensee: Erholung trifft auf dunkle Geschichte
Entdecken Sie den Plötzensee in Berlin: Ein Ort der Erholung und des Gedenkens an über 2900 NS-Opfer der Geschichte.
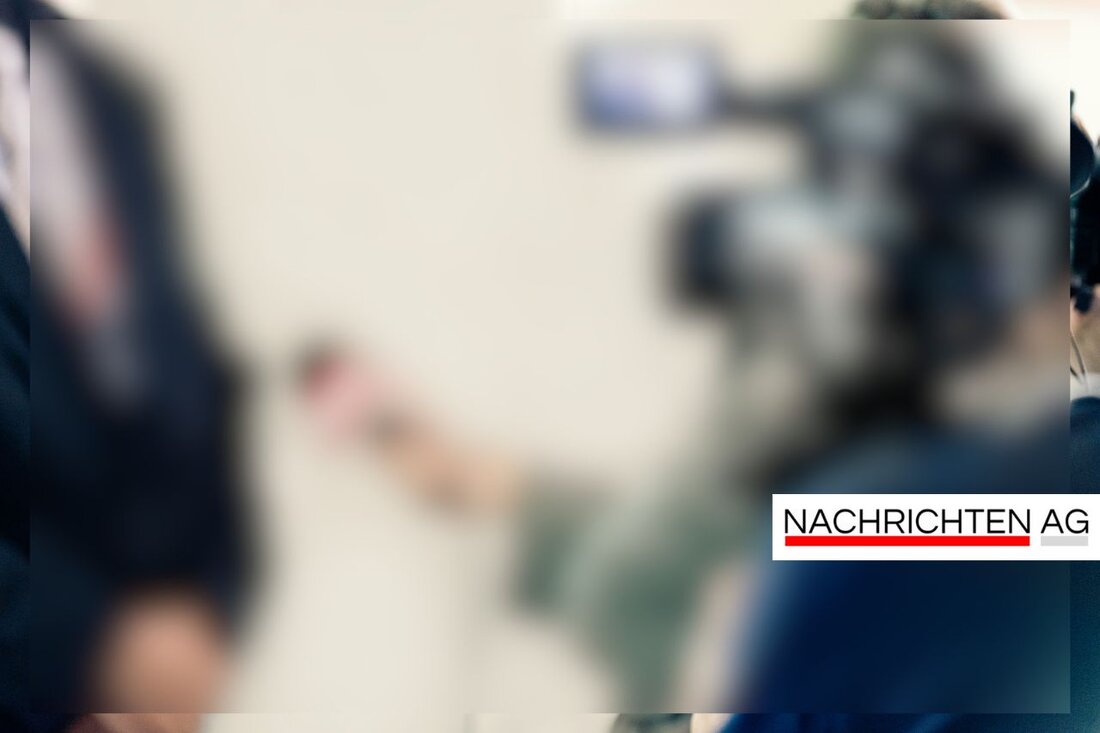
Schwimmen im Plötzensee: Erholung trifft auf dunkle Geschichte
Stellt euch einen Ort vor, der gleichsam für Erholung als auch für Gedenken steht. Hier in Berlin, am Plötzensee, wird genau diese Dualität lebendig. Mit seinen 7,7 Hektar ist der Plötzensee nicht nur ein beliebter Anlaufpunkt für Badelustige – jährlich schwimmen dort bis zu 10.000 Menschen, sonnen sich am Sandstrand oder genießen die Möglichkeiten für Wassersport. Doch der See birgt auch eine düstere Geschichte: Während des Nationalsozialismus fanden hier über 2900 Hinrichtungen statt. Diese erschütternde Wahrheit wird durch die nahegelegene Gedenkstätte Plötzensee sichtbar, die an die geschätzten 3000 Menschen erinnert, die zwischen 1933 und 1945 hier von den Nazis hingerichtet wurden, darunter auch viele, die sich dem Regime widersetzten.
Die Gedenkstätte, nur wenige Schritte vom Strandbad entfernt, ist ein eindrücklicher Ort des Erinnerns. Historiker betonen die Bedeutung dieser Kombination von Freizeit und Gedenken. Es ist ein einzigartiges Konzept der Erinnerungskultur, das die Vergangenheit nicht ausblendet, sondern aktiv integriert. Am Plötzensee kommen die Besucher nicht nur zum Schwimmen, sondern treten auch in einen Dialog mit der Geschichte. Viele haben sich zum Ziel gesetzt, dieses Bewusstsein zu fördern. Verantwortliche planen Maßnahmen wie Informationstafeln, die über die Geschichte des Ortes aufklären sollen und eine behutsame Modernisierung der Infrastruktur.
Die Gedenkstätte und ihre Geschichte
Das Plötzensee-Gefängnis wurde zwischen 1868 und 1879 erbaut und diente ab 1933 zunehmend zur Verhaftung und Hinrichtung politischer Gefangener. Die Hinrichtungen fanden meist im Gefängnishof durch Guillotine oder ab 1942 im Hinrichtungsraum durch Erhängen statt. Unter den Hingerichteten waren auch Mitglieder des Roten Orchesters und Teilnehmer des gescheiterten Putsches vom 20. Juli 1944. Es ist auffallend, dass fast die Hälfte der Verurteilten keine Deutschen waren.
Die Gedenkstätte wurde 1951 eingerichtet und 1952 eröffnet, wobei sie den Opfern von Hitlers Diktatur gewidmet ist. Der Raum, in dem die Hinrichtungen stattfanden, hat sich in einen Erinnerungsraum verwandelt und umfasst auch eine Ausstellung, die das NS-Gerichtssystem und die Schicksale der Verfolgten dokumentiert. Hier wird die Erinnerung aktiv gelebt, nicht in Form von Vergessen, sondern durch den ständigen Austausch über die Geschehnisse der Vergangenheit.
Ein Ort für die Zukunft
Die Pfleger der Gedenkstätte haben ein gutes Gespür für den Umgang mit der komplexen Geschichte des Ortes. Sie sehen die Verbindung von Erholungsort und Gedenkstätte nicht nur als Herausforderung, sondern als eine Chance, die Aktivitäten weiter auszubauen. Der Weg der Erinnerung verbindet die Gedenkstätte Plötzensee mit verschiedenen Kirchen, die ebenfalls den Widerstand gegen die Nazis gedenken, darunter die Paul-Hertz-Siedlung, die mit Werken von Alfred Hrdlicka ausgestattet ist und die Geschichten der Opfer künstlerisch zum Ausdruck bringt.
Mit den offenen Türen der Gedenkstätte und den regulären Öffnungszeiten von März bis Oktober täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr sowie von November bis Februar von 09:00 bis 16:00 Uhr, lädt der Plötzensee dazu ein, sowohl seinen Geschichten zuzuhören als auch in seiner Schönheit zu entspannen.
Wenn ihr mehr über die eindrückliche Geschichte des Plötzensees erfahren wollt, besucht die offizielle Webseite der Gedenkstätte visitBerlin oder die informative Seite von journee-mondiale und informiert euch über die wichtige Arbeit, die hier geleistet wird, um die Erinnerung an die Opfer lebendig zu halten.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto