Cottbuser Gericht weist Eilantrag der Umwelthilfe gegen LEAG zurück
Das Verwaltungsgericht Cottbus lehnt den Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe zur Leag-Umstrukturierung ab.
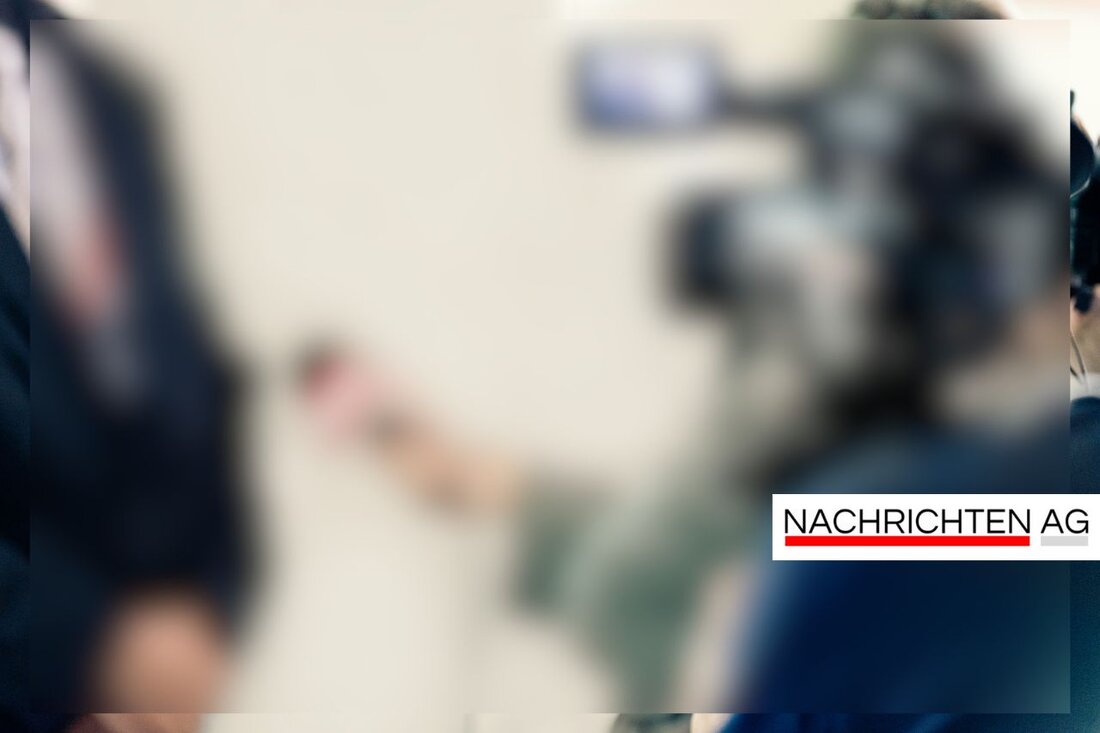
Cottbuser Gericht weist Eilantrag der Umwelthilfe gegen LEAG zurück
Das Verwaltungsgericht Cottbus hat am 25. September 2025 einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) abgelehnt, der sich gegen das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) richtete. Der Antrag hatte zum Ziel, das LBGR zur Forderung zusätzlicher Finanzsicherungsmaßnahmen von der Lausitzer Energie AG (Leag) zu bewegen, um Geld für die Rekultivierung des Tagebaus Jänschwalde zu sichern. Die Umwelthilfe äußerte Bedenken gegenüber der Umstrukturierung der Leag und den möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Diese Bedenken teilt auch Greenpeace, das ebenfalls am Eilantrag beteiligt war und von den Bundesländern Sachsen und Brandenburg die Beantragung von Gläubigerschutz fordert. In einer Pressemitteilung erklärt die DUH, dass die Umstrukturierung dem Leag-Konzern bis zu zwei Milliarden Euro an Vermögenswerten entziehen könnte und in der Folge das Eigenkapital der Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) um 82 Prozent reduziert werden soll. Diese Entwicklungen könnten erhebliche finanzielle Folgen haben und die langfristige Sicherstellung von Rekultivierungsmaßnahmen gefährden.
Das Verwaltungsgericht hat die Sichtweise der Umweltverbände nicht geteilt und den Antrag abgewiesen. Eine Beschwerde gegen diesen Beschluss kann beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden. Die Frist zur Geltendmachung eines Gläubigerschutzanspruchs endet am 1. Oktober 2025, was die Dringlichkeit der Angelegenheit unterstreicht.
Kritik an der Rekultivierung und ihrer Folgen
Die Umstrukturierungspläne der Leag stehen im Kontext einer intensiven Diskussion über die Folgen der Braunkohleförderung und der Rekultivierung. Laut Bund-nrw wurden bis Ende 2021 im Rheinland über 33.000 Hektar Land durch Braunkohlentagebau beeinträchtigt. Von diesen Flächen konnten lediglich 23.876 Hektar wieder nutzbar gemacht werden, während die ökologischen Langzeitfolgen schwerwiegende Bedenken hervorrufen. Der Verlust von fruchtbaren Böden, gravierende Eingriffe in den Grundwasserhaushalt sowie nicht ausgleichbare Verluste an Waldflächen sind nur einige der Punkte, die Umweltexperten vorbringen.
Die Debatte über die Rekultivierung wirft auch Fragen über die Qualität der wiederhergestellten Böden auf. Die sogenannten Neulandböden erreichen oft nicht die landwirtschaftlichen und ökologischen Qualitäten, die die ursprünglichen Böden besaßen. Ein gesunder Ökolandbau wird dadurch über Jahre eher zur Utopie als zur Realität, was besonders für die Region und ihre Anwohner große Herausforderungen mit sich bringen könnte.
Umweltorganisationen warnen
Die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace warnen weiterhin, dass die aktuellen Entwicklungen rund um die Leag und die anhaltende Braunkohleförderung die ökologischen Grenzen überschreiten. Ein Blick auf die Geschichte der Renaturierung zeigt, dass frühere Aufforstungsversuche, die nach dem Zweiten Weltkrieg unternommen wurden, oft nicht den gewünschten Erfolg hatten – eine wichtige Lehre aus der Vergangenheit, die es zu berücksichtigen gilt.
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass der Eilantrag der Umwelthilfe abgelehnt wurde, die Probleme und Herausforderungen rund um die Braunkohle und Rekultivierung jedoch keinesfalls kleiner werden. Daher bleibt die Frage, wie die Zuständigen darauf reagieren wollen, um sowohl ökonomische Interessen als auch den Schutz der Umwelt in Einklang zu bringen. Die kommenden Wochen und Monate könnten entscheidend für die Zukunft der Region sein.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto