64 Jahre Mauerbau: Schwerin gedenkt der Opfer nach Freiheit strebten
Am 13.08.2025 gedenkt Schwerin der Maueropfer und reflektiert über den Preis der Freiheit im Schatten der deutschen Teilung.
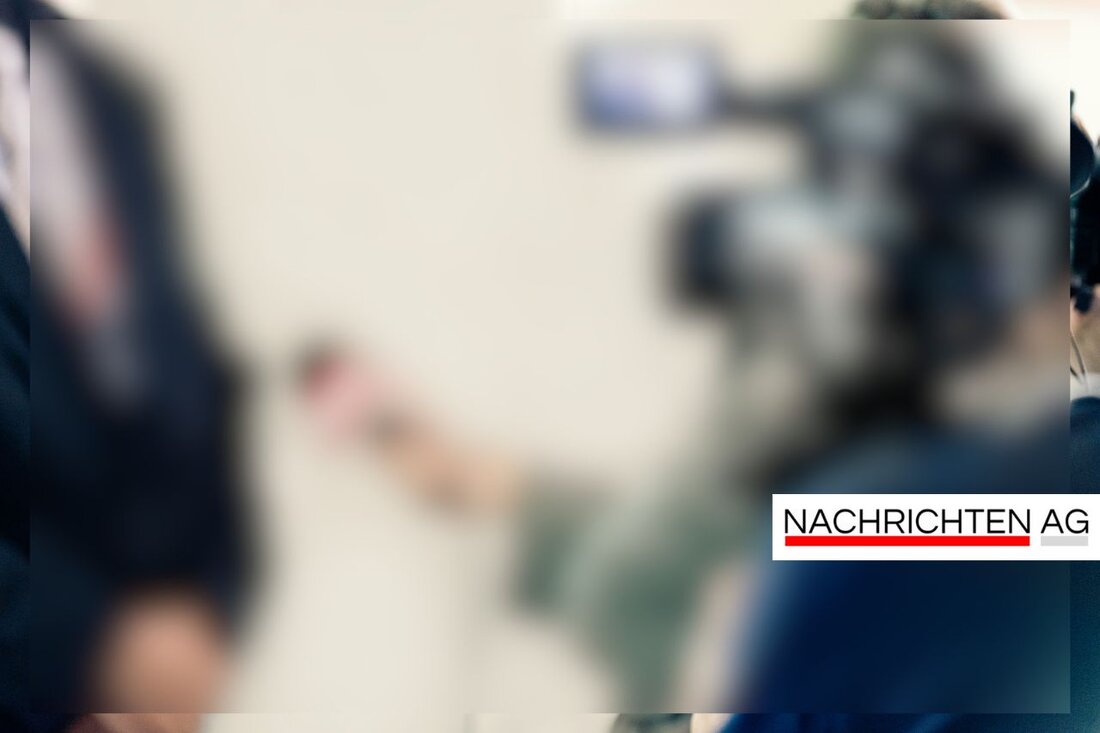
64 Jahre Mauerbau: Schwerin gedenkt der Opfer nach Freiheit strebten
Am 13. August 2025 gedachten viele Menschen in Schwerin an den Mauerbau, der vor 64 Jahren einen tiefen Einschnitt in die deutsche Geschichte darstellt. Bei der Kranzniederlegung auf dem Demmlerplatz betonte die Vize-Stadtpräsidentin Cordula Manow (Linke) den unermüdlichen Wunsch vieler nach Freiheit, den zahlreiche Menschen damals mit ihrem Leben bezahlt haben. Diese Erinnerungsveranstaltung zog auch Bürgerbeauftragten Christian Frenzel sowie Vertreter mehrerer Stadtfraktionen an, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgten: die Opfer des DDR-Grenzregimes solle in Erinnerung bleiben.
Die Bedeutung dieses Gedenkens wird auch durch die Worte von Jochen Schmidt, dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, unterstrichen. Er hob die dramatischen Auswirkungen hervor, die der Mauerbau auf das Leben von Familien und Freunden hatte. Die emotionale Last, die aus der Abriegelung der innerdeutschen Grenze resultierte, bleibt bis heute spürbar. Eine Tafel am Eingang zum Landgericht am Demmlerplatz erinnert an die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft und sollte uns stets die Kostbarkeit von Demokratie und Freiheit vor Augen führen.
Ein düsteres Kapitel der Geschichte
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Laut einer umfassenden Recherche über die Todesopfer des DDR-Grenzregimes, veröffentlicht in einem biografischen Handbuch im Jahr 2017, dokumentieren sich 327 Lebensgeschichten von Menschen, die im Zusammenhang mit dem Grenzregime ihr Leben verloren haben. Diese erschreckende Bilanz umfasst:
- 238 Todesfälle im innerdeutschen Grenzgebiet
- 25 im Dienst getötete DDR-Grenzbeamte
- 21 Todesfälle aufgrund des Grenzregimes
- 43 Selbsttötungen von Grenzpolizisten und Grenzsoldaten
Die meisten dieser Todesfälle wurden durch Schüsse von sowjetischen Grenzstreifen, der DDR-Grenzpolizei und NVA-Grenztruppen verursacht. Dabei reicht die Liste der Tragödien weit zurück: Der erste dokumentierte Todesfall nach der Gründung der DDR zählt zu den dunkelsten Momenten und ereignete sich am 16. Oktober 1949.
Vom „kleinen Grenzverkehr“ zur Mauer
Bis zum Mauerbau war ein gewisser Verkehr zwischen Ost- und Westdeutschland möglich. Dieser sogenannte „kleine Grenzverkehr“ wurde jedoch von der DDR als illegal betrachtet. Zwischen 1946 und 1947 wurde etwa 146.872 „illegale Grenzübertritte“ verzeichnet. Die Grenzsicherung unterlag ab 1955 allein der Deutschen Grenzpolizei, und die Möglichkeiten für DDR-Bürger, gefahrlos in den Westen zu fliehen, endeten schlagartig mit dem Bau der Mauer.
Von 1961 bis 1989 gelang es über 40.000 Menschen, die Grenze zu überwinden, während jährlich 3.000 bis 4.000 Fluchtversuche vereitelt wurden. Die physische und psychische Belastung für die Grenzsoldaten war enorm. Dies führte unter anderem zu dokumentierten Selbsttötungen, die häufig aus dem Druck und den Anweisungen resultierten, die den Schusswaffeneinsatz gegen Flüchtlinge rechtfertigten.
Das letzte dokumentierte Todesopfer durch Schusswaffengebrauch an der DDR-Westgrenze geschah am 25. Januar 1984. Damit bleibt die Geschichte der Mauer, die Familien auseinanderriss und Tausende in den Tod trieb, bis heute ein wichtiges Thema unserer Erinnerungskultur. Darauf macht auch die umfassende Forschung aufmerksam, die die Umstände und Todesfälle im Kontext des Grenzregimes weiterhin als offenes Feld betrachtet.
Nordkurier berichtet über den Gedenktag in Schwerin und die wichtigen Reden, die daran gerichtet wurden. Für weitere Informationen ist die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung eine wertvolle Ressource, die tiefergehende Einblicke in die Todesopfer des DDR-Grenzregimes bietet.

 Suche
Suche